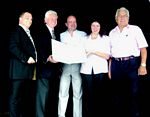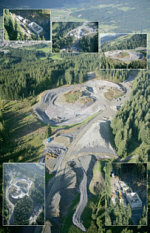21 Produkte stellten sich dem Schneitest in Lech
Nach über 5 Jahren hat endlich von 12.–14. Jänner bei den Skiliften Lech/Arlberg wieder ein internationaler Schneitest stattgefunden – mitorganisiert von MOUNTAIN MANAGER. 21 Schneeerzeuger von 11 Marken sind in 42 Testdurchgängen angetreten, um Prüfprotokolle erstellen zu lassen, die ca. 20 Parameter messen im Verhältnis zur jeweiligen Feuchtkugeltemperatur der Prüfzeit. Obwohl sich für die Schneeanlagenbetreiber daraus eine wertvolle Orientierung ergibt, haben die Firmen TechnoAlpin und DEMAC leider ihre Teilnahme am Schneitest verweigert – trotz persönlicher Animationsversuche der Organisatoren…
Schneitest in Lech bei der Schlegelkopfbahn am 12./13. Jänner mit 21 teilnehmenden Schneegeneratoren. Im Hintergrund die Areco Supersnow II mit Franz Schlemmer bei ihrem 1. Testdurchgang. Fotos: mak
Beim Schneitest geht es nicht darum die aktuell „beste“ Schneemaschine herauszufinden, denn „die beste Schneekanone gibt es nicht, sonst hätte ich sie schon erfunden“, behauptet DI Techn.-Rat Michael Manhart, Schneipionier seit 1973 und GF der Skilifte Lech. Manche Maschinen leisten viel und brauchen auch viel Energie oder Druckluft, andere leisten im Grenztemperaturbereich besonders viel und dafür bei tiefen Temperaturen weniger als andere, manche sind besonders lärmarm oder werfen sehr weit und manche sind eben kostengünstiger und erlauben bei gleichen Anschaffungskosten eine höhere Stückzahl. Jeder muss sich also seine spezielle Mischung aus den Parametern selbst zusammenstellen und dann den entsprechenden Schneegenerator dazu finden. Oder er lässt sich beraten. Allerdings ist eine unabhängige Auseinandersetzung mit den am Markt erhältlichen Geräten immer von Vorteil und dafür braucht es eben objektive Anhaltspunkte – wenngleich diese Anhaltspunkte nur immer Ausschnitte aus der möglichen Gesamtperformance einer Schneemaschine anzeigen.
Heinz Hofer, GF der Firma Nivis, mit seiner „Storm auomatic“ bei den letzten Einstellarbeiten vor der Messung.
6 Messzeitpunkte pro MaschineIn der Praxis sieht das so aus, dass bei einem Schneigerät nach 15–20 Minuten Rüstzeit z. B. bei – 6,5° C FKT die Messung aller Parameter startet und das erste Mal aufgezeichnet wird, ein weiteres Mal nach 7,5 Minuten Schneizeit bei eventuell abweichender FKT von z. B. – 6,0° C und das dritte Mal am Ende der Prüfung nach 15 Minuten bei eventuell nochmals abweichender FKT von z. B. – 5,8° C. Normalerweise sind die Abweichungen geringer (ø – 0,2° C FKT), außer es fällt während der Prüfung plötzlich Sonne ein, wie im oben beschriebenen Fall. Dies wird jedoch im Prüfbericht vermerkt. Nach Beendigung des gesamten Messdurchganges werden auch die Werte für die Wurfweite, Schneegewicht und Schneequalität (trocken, feucht, mit Sumpf etc.) eruiert. Zu diesem Zweck werden Schneibretter in Abständen von je 5 Metern platziert und der darauf angesammelte Schnee hinterher ausgewertet. Auf diese Weise wird auch das Hauptschneifeld ersichtlich. Zuletzt wird der maximale Wasserdurchsatz bei 35 bar ermittelt. Es stehen also nach den beiden Testdurchgängen, die jede angemeldete Schneemaschine in den 3 Testtagen durchläuft, insgesamt 6 Ergebnisse für die variablen Parameter (z. B. Wasserdurchsatz) und 2 Ergebnisse für die fixen Kriterien wie „durchschnittliches Schneegewicht“ oder „Verhältnis elektrische Energie: Schnee“ fest, die in einem Prüfprotokoll – beglaubigt von Schneichef Sepp Moser und GF Michi Manhart – festgehalten werden.
Techn.-Rat DI Michael Manhart, GF des Veranstalters Skilifte Lech mit 35 Beschneiungsjahren Erfahrung, beim Interview mit dem ORF Vorarlberg über den Schneitest.
Exklusive Veröffentlichung bei MOUNTAIN MANAGERDiesem Verfahren – für alle generell im manuellen Betrieb, die Maschinen konnten also während des Tests nicht regeln – stellten sich wie o. e. 21 Produkte, darunter erstmals welche von Areco, SMI und IAG (ehemals Zottl), nicht aber von TechnoAlpin, Demac und Cortech. Die Test-Reihenfolge wurde durch Los ermittelt. MOUNTAIN MANAGER wird die Prüfprotokolle in einer Sonderbeilage in der Messe-Ausgabe MM2 veröffentlichen und alle Abonnenten kostenlos mit 1 Exemplar bestücken. Die teilnehmenden Firmen haben bisher nur ihre eigenen Daten auf USB-Stick bekommen und können die Ergebnisse der Mitbewerber daher offiziell nicht nutzen oder bewerten – auchwenn inoffizielle Aufzeichnungen von einzelnen Teilnehmern während der Konkurrenzprüfungen gemacht wurden. Das Ergebnis ist erst offiziell, wenn es im MOUNTAIN MANAGER veröffentlicht wurde!
Ermittlung des Schneegewichtes bzw. Schneehöhe durch Sepp Moser.
Teilnehmer und GeräteARECO: SuperSnow IIBächler: Lanze NessyHDP Gemini: „Gemini S20A“, Lanze „Gemini ECO Superplus K“IAG GmbH: BK 100S (ehem. Zottl)Lenko: FA 540, FA 380, Lanze OrionNivis: „Storm automatic“Snowstar: Super Crystal, Schneilanze PegasusSMI/Wintertechnik: SMI Gigastar Simatic, SMI Super PoleCat Simatic, SMI PoleCat Piano SimaticSUFAG: Compact Power, Super Silent, Lanze S10–4, Arlberg Jet (Druckluftkanone), Arlberg Jet TwinYORK: Lanze RUBIS 10 CC, Lanze SAFYR
Schneilanze YORK Saphyr beim 1. Messdurchgang.
zurück
drucken
Download (PDF)