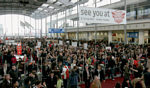Deutsche Seilbahner tagen in Willingen
Rund 150 Vertreter der VDS-Mitgliedsunternehmen besuchten Ende Oktober die Deutsche Seilbahntagung 2008 in Willingen. Mit guten Saisonverläufen im Rücken beschäftigten sich die Seilbahner insbesondere mit spezifischen Trends und Tendenzen im Gästeverhalten und in der Ausgestaltung des eigenen Sommer- bzw. Winterangebots.
Die VDS-Spitze mit denWillinger Referenten: Prof. Dr. Ralf Roth, StefanWirbser, stv. VDS-Vorsitzender, Geschäftsführerin Birgit Priesnitz, Prof. Karl Born und VDS-Vorsitzender Peter Huber.
Zahlen stimmenDie Stimmung ist gut unter den deutschen Seilbahnern. In Willingen konnten die Verantwortlichen von einem erfreulichen Verlauf der Saison 2007/2008 berichten. So zeigte das Wintergeschäft mit insgesamt 4,6 Millionen Gästen und Nettover-kehrseinnahmen von 54,3 Mio. Euro eine deutliche Steigerung gegenüber dem witterungsbedingt sehr schlechten Vorjahresergebnis (3,2 Mio. Gäste; 36,7 Mio. Euro). Auch das Sommergeschäft läuft – für die deutsche Szene mit ihrem im eu-ropäischen Vergleich hohen Anteil von Ausflugsbahnen ein besonders wichtiges Kriterium.Waren es 2007 noch insgesamt 2,8 Millionen Gäste, die das Sommer-angebot der 160 Seilbahnen und 4 Zahnradbahnen utzten (Netto: 33,1 Mio. Euro), so zeigen die vorläufigen 2008-Zahlen einen nochmaligen Anstieg auf 2,9 Mil-lionen Gäste (netto: 34,4 Mio. Euro). Dabei dürften sich auch erste Effekte des seit Jahresbeginn geltenden reduzierten Mehrwertsteuersatzes (7%) für Seilbahn-Beförderungsleistungen auszahlen. Im Fünf-Jahresdurchschnitt registrieren die deutschen Bahnen laut VDS-Geschäftsführerin Birgit Priesnitz für das Sommergeschäft ein Plus von 6 Prozent.Eigenes Profil suchenEtwa zwei Drittel der deutschen Seilbahnen sind im Alpenraum, die übrigen (sport-)touristischen Anlagen verkehren in typischen Mittelgebirgslagen. Was hier technisch möglich ist, wurde den Kongressteilnehmern sehr anschaulich im Tagungsort Willingen vorgeführt, wo alleine auf die vergangene Saison über 18 Millionen Euro in neue Bahntechnologie und vor allem in eine leistungsfähige Beschneiung investiert wurden. Wenn auch weitere Unternehmen gerade in die Schneeversicherung investierten – z. B. die Nebelhornbahn mit der Komplettbeschneiung von Deutschlands längster Abfahrt (7,5 km) – für viele andere Unternehmungen in Mittellagen, aber auch im deutschen Alpengürtel fehlen derzeit die Möglichkeiten für derlei „Hochrüstung“. Stattdessen arbeiten die Verantwortlichen an einer immer stärkeren Diversifizierung und gerade im Winter unter dem Motto „Näher dran“ (am Gast) an attraktiven Angeboten für spezifische Zielgruppen. Insbesondere Familien mit Kindern stehen hier im Fokus – Beispiele aus dem Bayerischen Wald sind etwa das „Arbär-Kinderland“ am Arber oder der Junior-Skizirkus in Mitterfirmiansreut. Familienorientiert bauen viele Gebiete derzeit auch ihr Rodelangebot aus oder ziehen die Technik-Karte, wie der Feldberg im Schwarzwald, wo Gäste im Pistengerät mitfah-ren können. Voll im Trend liegt auch das Winterwandern, in das viele deutsche Gebiete als weniger schneekritische Variantemit der Auszeichnung neuer Routen investieren.Den Kunden abholenIn Willingen kamen natürlich auch die zukünftigen Herausforderungen für den deutschen Ski- und Seilbahntourismus zur Sprache. Gerade dabei erhält das Motto Näher dran“ eine direkte Bedeutung, wenn es darum geht, einen profitablen Anteil der geschätzten rund 8 bis 9 Millionen deutschen Skifahrer im Land zu hal-ten. Mögen dazu ständig steigende Reisekosten und auch Mehrwertsteuer-Erleichterungen beitragen, letztlich machen die Qualität des Angebots und ein um-fangreicher Service die erfolgreiche Gästeansprache aus.Zwei Grundsatzreferate boten hierzu Hilfestellung. Prof. Dr. Ralf Roth von der Deutschen Sporthochschule Köln bestätigte in seinem Beitrag die wichtige Rolle der Seilbahnen als wichtige touristische Motoren in Berggebieten. In Zusammenarbeit mit lokalen Partnern haben sie die Möglichkeiten, das Angebot im Gebiet entsprechend der Herausforderungen durch den Klimawandel oder der demogra-phischen Entwicklung anzupassen. Aktuelle Umfragen unter Betreibern und Gästen zeigen, dass es wichtige Übereinstimmungen in der Erwartungserhaltung gibt, auf die sich aufbauen lässt. So tritt das Skifahren als einzige Motivation für den Winterurlaub am Berg etwas in den Hintergrund. Ein angemessenes Angebot an beschneiten, bestens präparierten Einzelpisten oder Funparks wird zu einem wichtigen Teil im diversifizierten Freizeitprogrammvon erfolgreichen Ferienorten, das sich zudem durch Naturerlebnisse, kulturellkulinarische oder soziale Komponenten auszeichnet. Auch für den Tourismusforscher Prof. Karl Born von der Hochschule Harz in Wernigerode ist die Auseinandersetzung mit den Gästeerwartungen natürlich die wichtigste Voraussetzung für einen erfolgreichen Tourismusstandort. Born identifizierte zukünftige Trends im Urlaubsverhalten, wobei für den Bergtourismus insbesondere die Stichworte „Gesundheit“ und „kulturelle Identität“ (i. S. gewachsener Einzigartigkeit) wichtig seien. Noch stärker müssten sich Tourismusanbieter allerdings auch mit bislang eher grob identifizierten Zielgruppen beschäftigen. So sind zum Beispiel „Senioren“ nicht einfach „50+“, und „Singles“ lassen sich nicht einfach unter „alleinreisend“ und entsprechend kontaktfreudig subsumieren. Wer sich also nur mit „Seniorentellern“ und „Dating-Partys“ auf diese Zielgruppen einstellt, hat verloren. „Der Wandel vom Produktkenner zum Kundenkenner hat sich längst vollzogen“ – es reicht nicht mehr nur das Beste aus den Möglichkeiten seines Ferienortes zu machen, es müssen aktiv Möglichkeiten für zielgruppengerechte Aktivitä-ten geschaffen werden. Höchste Servicequalität ist dabei heute eine Grundvoraussetzung und keine besondere Auszeichnung mehr. tb
zurück
drucken
Download (PDF)