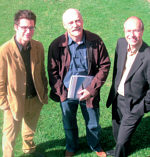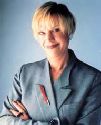40 Jahre Frey AG Stans: Von der Zufallsbekanntschaft zum Marktführer
Mit insgesamt 410 Gästen und Mitarbeitern feierte die Frey AG Stans Anfang September ihr 40jähriges Bestehen. Der Anlass auf dem Flugplatz Buochs, unweit des Frey-Firmensitzes in Stans-Oberdorf, war geprägt vom Selbstbewusstsein eines Leaders in einem hochspezialisierten Markt, der seine Tradition und Zukunft im Dienst am Kunden sucht und findet.
Seit 1969 residiert die Frey AG Stans mit Verwaltung und Produktion am Standort Stans-Oberdorf. Das Unternehmen beschäftigt heute über 70 hochqualifizierte Mitarbeiter und ist einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region.
Historischer Start-upWas heute als ein Inbegriff an Verlässlichkeit und Sicherheit steht, begann mit einem Zufall, wie Verwaltungsratspräsident und Unternehmenschef Peter Frey in seinen Grußworten an die Festgäste bekannte. Eigentlich suchte sein Vater, Unternehmensgründer Fritz Frey, vor vierzig Jahren einen Technischen Leiter für das damals im Familienbesitz stehende Bürgenstock-Hotel. Es meldete sich der Elektroniker Gerhard Hürzeler, selbst auf der Suche nach einem sicheren Standbein neben seiner kleinen Zwei-mann-Firma für Seilbahnsteuerungen. Die Affinitäten waren gegeben – der Familie Frey gehörten damals neben der Bürgenstockbahn auch mehrere Elektro-Betriebe. Fritz Frey übernahm kurzerhand Hürzeler samt Kleinbetrieb und stieg am Standort Stans in die Entwicklung und Fertigung von Seilbahnsteuerungen ein. Und fand einen dynamischen Markt vor, der die junge erfolgreiche Frey AG Stans schon 1969 aus dem angemieteten Garagenbetrieb an den heutigen Firmen- und Produktionssitz in Stans-Oderdorf übersiedeln ließ. Damals noch neun große Seilbahnbauer und der sich rasant entwickelnde Bedarf an bergtouristischen und industriellen Seilbahnlösungen führten das Unternehmen auch schnell über die Grenzen des „Seilbahnkantons Nidwalden“ (Peter Frey) in die Welt. Meilensteine der frühen siebziger Jahre waren unter anderem die elektrischen Ausrüstungen für fünf 80-Personen-Pendelbahnen und drei Schwerlast-Materialbahnen im indonesischen Westirian.
Bei strahlendem Festwetter folgten über 400 Gäste und Mitarbeiter der Jubiläums-Einladung auf den Flughafen Buochs.
(Fort-)SchrittmacherTechnologisch blieb man nicht nur auf der Höhe der Zeit, sondern wurde zum echten Schrittmacher im Seilbahnbereich. Die Übergänge von der Elektromechanik zur Vollelektronik bis hin zu den heute überall anzutreffenden Computersteuerungen wurden entscheidend von Stans aus mitgeprägt. Von mechanischen Kopierwerken aus eigener Produktion zur Fahrzeug-Standortermittlung und den Steuerungen für die voluminösen Ward-Leonard-Antriebe ging die Entwicklung über die ersten thyristorgespeisten Gleichstromantriebe (ab 1978), den elektronischen Kopierwerken (ab 1986) zu den heute aktuellen programmierbaren Steuerungen (PSS) und Frequenzumrichter-Antrieben (1998 bzw. 2000). Hinzu kamen Kommunikationsund Überwachungssysteme, die nicht nur den Betrieb immer sicherer machten, sondern durch moderne Visualisierung auch die Bedienungvereinfachten – weg vom riesenhaften Analogsteuerpult hin zum PC-Terminal mit intuitiv bedienbarem Touchscreen. Die Revolutionen vollzogen sich dabei freilich meist im verborgenen – die breite Öffentlichkeit, will heißen der Fahrgast, bekam davon im Normalfall des störungsfreien Betriebs nichts mit. Umso stolzer ist man in Stans deshalb auch, dass viele der spektakulärsten Bahnbauten in den vergangenen vier Jahrzehnten das imaginäre Label „Frey AG inside“ tragen. Insgesamt fahren bis heute rund 1 300 Seilbahnen in 44 Ländern mit Antriebstechnik und Steuerungen aus Stans.
Peter Frey (Mitte) mit den Gastreferenten des Festabends: Dr. David Bosshart (l.), CEO Gottlieb Duttweiler Institut fürWirtschaft und Gesellschaft und einer der Väter des erfolgreichen Migros-Konzepts, plädierte für eine klare Ausrichtung des Schweizer Tourismusmarketings an neuen gesellschaftlichen Werten – nicht an kurzfristigen Moden und Trends; Thomas Bucheli, RedaktionsleiterSF Meteo, erläuterte kurz- und langfristige Wetter- und Klimaphänomene.
Solide Basis für die ZukunftDie Frey AG Stans wird seit 1992 von Peter Frey geleitet, beschäftigt heute 73 Mitarbeiter und ist nach eigenen Angaben „kerngesund“. In Stans gab Peter Frey die Übernahme der deutschen EAG Elektronik Apparatebau GmbH bekannt: als neue Frey FUA AG werden die Aktivitäten des Weltmarktführers für Signal- und Sicherheitseinrichtungen an der angestammten Produktionsstätte in Markt Schwaben bei München weitergeführt.
Auch bei den USamerikanischen Metro-Shuttles der achtziger Jahre war die Frey AG Stans maßgeblich beteiligt.
Als größte Herausforderung am Markt für Seilbahnsteuerungen, den sich das Unternehmen als Schweizer Marktleader (ca. 60% Marktanteil) international mit zwei weiteren Anbietern teilt, sieht man einen wachsenden Kosten- und Leistungsdruck im Neu- und Umbausegment sowie wachsende Serviceanforderungen auf Betreiberseite.
Maschinen für Menschen: Ein wesentlicher Beitrag der modernen Steuerungstechnik ist die intuitive Bedienbarkeit komplexer Anlagen durch visualisierte Touchscreen-Panels.
Nur mit einem klaren Bekenntnis zu hoher Produkt- und Servicequalität, in deren Zentrum die maximale Sicherheit für Bahnbetreiber und Fahrgäste steht, lasse sich diesen Herausforderungen auch in Zukunft erfolgreich begegnen, so Peter Frey. Dass die Frey AG Stans hier auf dem richtigen Kurs ist, zeigt das laufende Geschäftsjahr, das sich nach Aussagen der Firmenleitung „hervorragend entwickelt“.tb