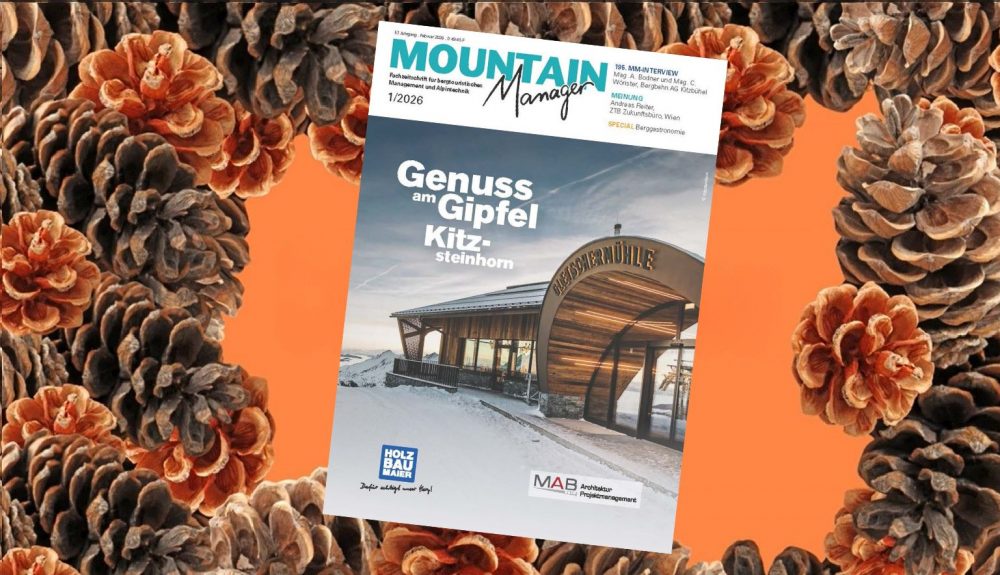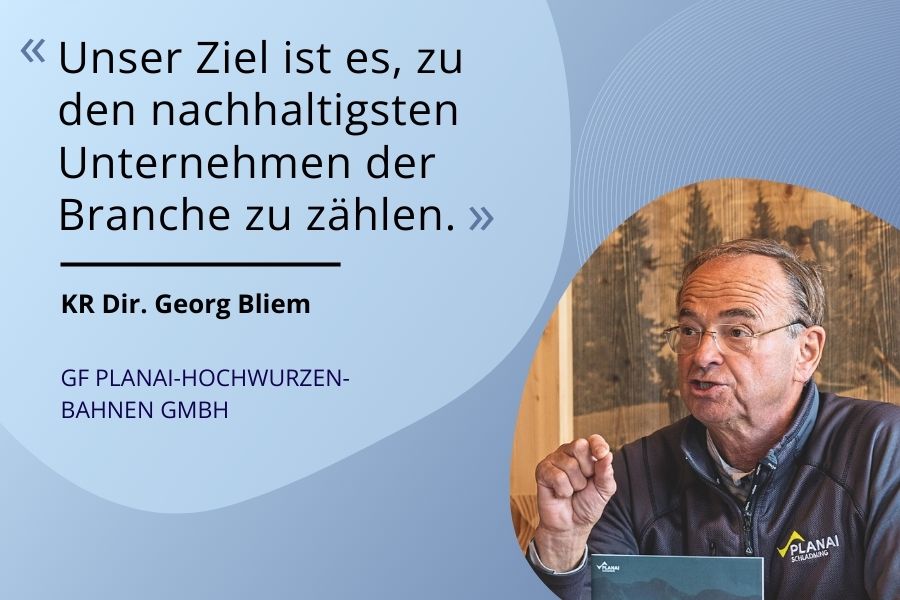© cm via Canva.com
„Unser Ziel ist es, zu den nachhaltigsten Unternehmen der Branche zu zählen“
Für 2026 hat KR Dir. Georg Bliem seinen Rückzug als Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH angekündigt. Er übergibt ein erfolgreiches Unternehmen mit durchdachten Angeboten, einer modernen Infrastruktur und nachhaltigem Wirtschaftskurs.
Die Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH gilt als touristischer Leitbetrieb. Wie haben sich die Herausforderungen in den letzten Jahren verändert, wo geht der Weg hin?
Die Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH wird nicht nur als Motor der Region bezeichnet, sie ist es auch und trägt deshalb eine große Verantwortung. Diese Verantwortung haben wir auch immer wahrgenommen. So wurde in den Jahren meiner Geschäftsführung viel in die Infrastruktur investiert, wobei wir u. a. neun Seilbahnen gebaut haben. In den nächsten Jahren wird die Absicherung des Skibetriebs im Fokus stehen. Dafür haben wir schon 2025 eine große Investition in Pumpanlagen durchgeführt. Nächstes Jahr wird ein bestehender Speicherteich auf ein Fassungsvermögen von rund 200.000 m³ Wasser vergrößert. Auf diese Weise wollen wir sicherstellen, dass für den Skibetrieb immer genug Schnee vorhanden ist. Dazu wird auch großes Augenmerk auf das Angebot, auf Inszenierungen am Berg gelegt werden, damit der Gast seinen Aufenthalt genießen kann. Dabei geht es nicht mehr nur um Angebote für eine Saison, sondern um eine Ganzjahresnutzung. Ein Ziel, das ich von Anfang an verfolgt habe, war es, die Planai-Hochwurzen-Bahnen zu einer Ganzjahresdestination zu entwickeln. Da sind wir auch angekommen – immerhin gelingt es mit einem entsprechenden Angebot, von unseren 420 Mitarbeitern 325 ganzjährig zu beschäftigen.

Biken hat sich im Sommerangebot der Planai-Hochwurzen-Bahnen zur Erfolgsgeschichte entwickelt. © Harald Steiner
In der GmbH sind neben der Infrastruktur der Bergbahnen auch die Bereiche Gastronomie, Freizeitparks, Sportanlagen, der Autobusbetrieb „Planai Bus“ sowie ein Reisebüro vertreten. Welche Bedeutung haben Synergien im Unternehmen und darüber hinaus?
Es war von Anfang an geplant, die Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH breiter aufzustellen, da sind Synergien essenziell. Das Bussegment „Planai Bus“ wurde in den letzten Jahren fast runderneuert, und das sowohl bei den Linienbussen als auch den Reisebussen. Wir bedienen mit den Linienbussen, die im Sommer und im Winter fahren, nicht nur Schladming, sondern auch 6 Hochtäler in den Schladminger Tauern. Dazu haben wir eine moderne Reisebusflotte im Einsatz, mit der wir Ziele in ganz Europa anfahren. Im Winter nutzen wir diese Flotte für Bustransfer-Fahrten vom Flughafen Salzburg nach Saalbach, Zell am See, Wagrain und natürlich Schladming. Im Bereich der Gastronomie haben wir 6 Standorte mit so herausragenden Betrieben wie etwa dem Gletscherrestaurant am Dachstein oder der Steinbockalm am Wilden Berg in Mautern. Am Wilden Berg in Mautern, den wir seit 10 Jahren im Rahmen eines Managementvertrages führen, konnten wir in dieser Saison 103.000 Besucher begrüßen. Der Tierpark mit 320 Tieren war für uns ein völlig neues Feld, in das wir uns erst einarbeiten mussten. Er hat sich aber sehr gut entwickelt. Weiters gehören zur Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH noch Beteiligungen. So betreiben wir mit Sport Bründl aus Kaprun in einer eigenen Gesellschaft die Sportgeschäfte vor Ort, dazu vermieten wir die von uns angemieteten Sporthausflächen an Geschäfte weiter, am Galsterberg etwa Sport Mandl oder an der Station Planai-West Sport Tritscher. Mit diesem breit gefächerten Aktionsradius haben wir ein gut funktionierendes Netzwerk, in dem eine gute Zusammenarbeit und Synergien natürlich sehr wichtig sind. Aber grundsätzlich muss sich jeder Bereich auch wirtschaftlich rechnen, jedes Segment wird als eigenständiges Profit-Center geführt. Wenn ich meine Agenden nächstes Jahr übergebe, kann ich Profit-Center übergeben, die alle profitabel wirtschaften.
Sie haben 2014 in einem Interview mit dem MOUNTAIN MANAGER gesagt, dass Nachhaltigkeit eine große Rolle im Unternehmen spielt. Was wurde auf den Weg gebracht?
Im Bereich der Nachhaltigkeit sind wir sehr ambitioniert. Unser Ziel ist es, zu den nachhaltigsten Unternehmen der Branche zu zählen. So sind die Planai-Hochwurzen-Bahnen nach ISO 9001 für Qualitätsmanagement und ISO 14001 für Umweltmanagement zertifiziert. Die Zertifizierungen wurden nach intensiven Vorbereitungen im Oktober 2023 verliehen. Grundsätzlich bekennen wir uns zu den drei Säulen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Soziales und Ökonomie. Um unsere Ambitionen vorzustellen, haben wir vor kurzem ein Magazin veröffentlicht, in dem viele unserer Projekte vorgestellt werden, etwa aus dem Bereich Energiemanagement. Wir haben im Skigebiet z. B. rund 230 Zählpunkte für den Energieverbrauch, dazu investieren wir umfassend in den Photovoltaikausbau. Ein absolutes Highlight war der Umbau der Dachstein Bergstation, die nun zu 80 % energieautark ist. Wir bauen jedes Jahr drei bis vier PV-Anlagen, 2025 u. a. auf der neuen Busgarage. Bis 2029 wollen wir so mindestens 16 % unseres Strombedarfs selbst erzeugen. Im Sommer haben wir außerdem eine „grüne Partie“ mit 12 Mitarbeitern im Einsatz, die sich nur mit der Landschaftspflege befasst. Das ist notwendig, weil bei uns auch der Sommertourismus sehr stark geworden ist. Da muss einfach alles passen. Die Planai-Hochwurzen-Bahnen waren eine der ersten Bergbahnen, die HVO eingesetzt haben, und das nicht nur bei unseren 25 Pistenfahrzeugen, sondern auch bei der Busflotte und den Firmen-PKW. Welche Ergebnisse der Einsatz von HVO bringt, haben wir getestet und die Tests wissenschaftlich durch die TU Graz sowie die Dr. Thomas Klein Consulting GmbH begleiten lassen. Dazu wurde in der Saison 2022/23 ein neues Prinoth Pistenfahrzeug wie üblich mit Diesel betankt, ein anderes mit HVO, sodass wir den direkten Vergleich hatten. Die Ergebnisse waren überzeugend: Es gab keinen Leistungsverlust durch die Betankung mit HVO, man braucht annähernd gleich viel Kraftstoff und es gab keine Auswirkungen auf die Maschinen, also etwa Abnützungserscheinungen.
Wie hat sich die Stabstelle „Nachhaltigkeit“ bewährt, die 2021 ins Leben gerufen wurde?
Die Stabstelle „Nachhaltigkeit“ hat zwei Mitarbeiter. Mit ihnen gemeinsam haben wir begonnen, unsere Nachhaltigkeitsprojekte klar zu definieren, sukzessive auf den Weg zu bringen und zu überwachen. Die Arbeit der Stabstelle ist ein „living process“, der sich permanent fortsetzen wird. An Themen wird es dabei nicht mangeln, ob das jetzt Wärmerückgewinnung betrifft, Nachhaltigkeit bei Lieferanten und natürlich bei allen Bauarbeiten, wo Nachhaltigkeit heute von der Planung weg in allen Schritten zum Tragen kommt.
Im letzten Winter haben Sie mit SolOcean eine neue PV-Anlage am Wasser getestet, wie waren Sie zufrieden?
Die erste Testphase war sehr gut. Die entscheidende Frage dabei war, wie reagiert eine Solaranlage am Speicherteich bei Eis und unterschiedlichen Wasserständen. Da hat sich das System gut bewährt. Wir haben in der letzten Saison mit den Tests allerdings erst im März begonnen und wollen deshalb jetzt noch die ganze anstehende Wintersaison, also auch bei extremen Bedingungen, weitertesten. Wenn die Ergebnisse passen, könnte ich mir vorstellen, dass es Potenzial gibt.
Mit welchen Neuerungen geht man dieses Jahr in die Wintersaison?
Wir haben 2025 30 Mio. Euro investiert, für nächstes Jahr haben wir 22 Mio. Euro beschlossen. Das Herzstück war dieses Jahr die Erneuerung der Skischaukel Hauser Kaibling–Planai. Dafür wurde für Hauser Kaibling eine 10er-Kabinenbahn von Leitner gebaut, die Senderbahn. Wir haben uns für eine 8er-Sesselbahn von Doppelmayr entschieden, der man den Namen „Mitterhausalm I“ gegeben hat. Die Sesselbahn bietet besten Komfort und wird im Endausbau bis zu 3.000 Personen pro Stunde befördern können. Gemeinsam haben Hauser Kaibling und die Planai im Rahmen des Projekts außerdem eine große Lagerhalle mit eigener Tankstelle realisiert, weil man in diesem Areal auch eine entsprechende Infrastruktur braucht. Eine Herausforderung bei diesem Projekt war sicher die Logistik und das Nebeneinander der Bauarbeiten für zwei sehr große Projekte. Das hat letztendlich aber alles sehr gut funktioniert.
Was wurde in den Jahren Ihrer Geschäftsführung investiert, wie hat sich das Verhältnis Winter-/Sommerangebot entwickelt?
In meiner Geschäftsführung habe ich Investitionen über 210 Mio. Euro zu verantworten, gebaut wurde also viel und mit Begeisterung. Das waren nicht nur Seilbahnen, auch Schneeanlagen und vieles mehr. Das Unternehmen konnte in dieser Zeit seinen Umsatz und seinen Cashflow mehr als verdoppeln. Die Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH ist also ein ausgesprochen gesundes Unternehmen und gut aufgestellt für die Zukunft. Der Großteil der Einnahmen kommt nach wie vor aus dem Winter, im Sommer erwirtschaften wir mittlerweile aber schon rund 20 % unseres Umsatzes. Ich gehe auch davon aus, dass der Sommer weiter zulegen wird. Für den Gast ist dabei nicht nur das Angebot am Berg ausschlaggebend, schon die Fahrt mit der Seilbahn wird zum Erlebnis. An guten Tagen bewegen wir im Sommer rund 15.000 Besucher. Die Zahlen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, jedes Jahr hat es mehr Gäste gegeben. Wenn man sich die Nächtigungen in der Region ansieht, so gibt es im Sommer mit 2 Mio. Nächtigungen gleich viele wie im Winter. Der Sommer in den Bergen hat also sicher noch Potenzial.
Wenn Sie die Investitionen der letzten Jahre Revue passieren lassen, welche waren für Sie am beeindruckendsten?
Das erste Projekt, das ich realisieren durfte, war die Hochwurzen-Gipfelbahn. Dann folgten weitere Meilensteine wie etwa die Planai-Hauptseilbahn. Die Ski-WM 2013 war ein besonderes Projekt, das Hopsiland 2015 und auch die Konzerte der letzten Jahre mit Robbie Williams oder dieses Jahr mit den Backstreet Boys. Es gibt eine ganze Reihe an Highlights. Etwas ganz Besonderes war aber sicher der Umbau der Dachstein Bergstation, das würde ich als Lebenswerk bezeichnen. Die Vorlaufzeit hat sich über viele Jahre erstreckt. Man musste den Permafrost und die Stabilität des Untergrunds testen, passende Planer und Professionisten finden, die auf 3.000 m bauen können und wollen. Das Ergebnis kann sich jetzt aber auch sehen lassen. Und natürlich musste immer alles wirtschaftlich passen, da braucht es einen „strengen Rechenstift“.
Danke für das Gespräch! lw
Brand new: The Mountain Manager Worldwide 15
The latest international edition in English is currently on its way to the readers and is also available online on our website. It includes highlights from the 2025 Mountain Manager issues as well as the latest news from the mountain tourism management and alpine technology.
Excerpt from the contents of the new MM Worldwide:
- Opinion: Theresa Haid, CEO Zukunftsmanufaktur Zell/Ziller: Greenwashing days are definitely over
- Interview with Hendrik Wiegand: 50 years of Wiegand – a unique success story
- SKIDATA provides the digital mountain experience
- Snow: Skiing on green mats
- Expert assessment from Prof. Ulrike Pröbstl-Haider, BoKu Vienna: 40 years of snowmaking and the environment – a resume
- Revolutionary floating PV technology from SolOcean
- Doppelmayr Group: AURO Assist about to make its entrance
- Bartholet: A New Era Begins on Monte Tamaro
- Doppelmayr builds its first ropeways in Kyrgyzstan
- LEITNER: Ropera® starts its first winter season this year
- LEITNER is consistently expanding
- MM-Interview: Manuel Schnell, Managing Director of Ski amadé: “The challenges have become ever greater.”
- Expert Talk: Focusing on the future of winter tourism
- US ski resorts: second best season on record
- Swiss Snow Technologies: Its all about snow
- A new generation begins with SUPERSNOW’s 900T and 900H
- Kässbohrer shapes the future of ski resorts together with its customers
- PistenBully and SnowSat celebrate major success in Japan
- Used snow groomers from PISTENTECH: The sustainable alternative
- OITAF seminar in Innsbruck: AI – is the cable car world facing a structural upheaval?
The MM-team wishes you an interesting and enjoyable read!
(v. li.n.re.) Hansjörg Pflauder, Vorstand Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen, Alexandra Bresztowanszky, Geschäftsführerin Bergbahnen Hochrindl und Josef Bogensperger jun., Obmann der WKO-FG Kärnten und GF der Katschbergbahnen. © WKK
Kärntens Seilbahnen investieren in Nachhaltigkeit
Kärntens Seilbahn-Unternehmen investierten zur Saison 2025/26 rund 55 Mio. Euro in neue Aufstiegshilfen, energieeffiziente technische Beschneiung, Photovoltaik-Anlagen und moderne Infrastruktur. Einen Schub für das Gästeaufkommen – bisher 3,3 Mio. Wintersportler – erwartet man sich durch die neue schnelle Zugverbindung mit der Koralmbahn in die Steiermark ab 14. Dezember.
In der Wintersaison 2025/26 dürfen sich Gäste auf zahlreiche Innovationen in Kärnten freuen. Am Katschberg ersetzt eine moderne Kabinenbahn mit energieeffizientem Antrieb die bisherige 3er-Sesselbahn Aineck. Die barrierefreien Kabinen bieten acht beheizbare Sitzplätze und bringen Wintersportler komfortabel auf 2.220 m. Auch am Nassfeld, Kärntens größtem Skigebiet, steht ein Meilenstein bevor: Im Dezember 2025 geht die neue Gartnerkofelbahn in Betrieb – eine 10er-Kabinenbahn, die die bisherige 4er-Sesselbahn ersetzt.
Energieeffizienz und Klimaschutz im Fokus
Der Fokus der Investitionen der Kärntner Skigebiete liegt eindeutig auf Energieeffizienz und Klimaschutz. Bad Kleinkirchheim, Gerlitzen und Katschberg errichten großflächige Photovoltaikanlagen, um Liftbetrieb, Pumpstationen und E-Ladestationen künftig mit eigenem Sonnenstrom zu versorgen. Parallel dazu werden Beschneiungsanlagen modernisiert, um Wasserverbrauch und Energieeinsatz zu optimieren. Zudem investierten viele Skigebiete in ihren Fuhrpark, insbesondere in neue Pistengeräte. Das Goldeck erweitert sein Angebot mit neuen Strecken wie der „Seeblick-“ und der „Glocknerpiste“ sowie der spektakulären „S1“ – einer der längsten schwarzen Pisten der Alpen. „Unser Ziel ist es, die Skigebiete schrittweise energieautark zu machen. Damit bekennen wir uns klar zu Klimaschutz, Qualität und regionaler Wertschöpfung“, erklärt Josef Bogensperger jun., Obmann der Kärntner WKO-Fachgruppe Seilbahnen und Geschäftsführer der Katschbergbahnen. Das Preisniveau bleibe aber trotz der hohen Investitionen stabil. Die Skipasspreise steigen im Durchschnitt um drei bis fünf Prozent. Skifahren ist in Kärnten weiterhin leistbar – in Mühldorf etwa schon ab acht Euro pro Tag.
Mehr Erlebnis am Berg
Neben der Technik setzen Kärntens Seilbahnen auch auf Erlebnisqualität. Neue gastronomische Highlights wie die „Goldalm – Mountain Dining“ am Goldeck oder modernisierte Hütten auf der Simonhöhe oder Weinebene sorgen für kulinarische Vielfalt auf höchstem Niveau. Für Familien und Kinder entstehen neue Erlebnisbereiche wie „Nockys Schneezeit“ auf der Turrach oder das rundum erneuerte Kinderschneeland am Falkert.
Der Kärntner Skipass bleibt weiterhin bestehen und verzeichnet bereits jetzt ein Plus bei den Onlineverkäufen. Der Vorverkauf ist noch bis 8. Dezember 2025 möglich, informiert Hansjörg Pflauder, Vorstand der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen und Ausschussmitglied der Fachgruppe. In der kommenden Saison 2025/26 Jahr werden neben den Familien- und Partnerpaketen auch wieder Großelternpakete sowie spezielle Angebote für Patchwork-Familien angeboten.
Die Baden-Württembergische Filmakademie hat eine 90-minütige Doku mit dem Titel „Abfahrt auf Zeit“ verfasst, die im Herbst in die Medien kommen wird. © Schneezentrum (6)
Der Klimawandel trennt die Spreu vom Weizen
Das Schneezentrum Tirol ist nun über ein Jahr in Obergurgl. Letztes Jahr deuteten die Testergebnisse in Richtung Effizienzsteigerung. Der MOUNTAIN MANAGER hakte nach, ob das immer noch so ist und was es ganz generell Neues gibt.
Michael, wie sieht es aktuell mit der Effizienzsteigerung aus?
Effizienz bleibt aus meiner Sicht die Herausforderung in allen Belangen. Früher gab es auf die Frage nach den drei wichtigsten Erfolgskriterien im Tourismus die flapsige Antwort: „Lage, Lage und nochmals Lage“. Die Herausforderungen durch den Klimawandel treiben diese für den Schneesport in die Richtung: „Effizienz, Effizienz und nochmals Effizienz“. Auch wenn die Lage, im konkreten Fall die Höhe des Skigebiets, natürlich eine entscheidende Rolle spielt, muss die Beschneiung an drei Effizienzkriterien ausgerichtet werden: die Qualität der Beschneiungsanlage, die Schlagkraft und das Schneemanagement. Was die Qualität der Beschneiungsanlage anbelangt, sind sehr umfangreiche Überlegungen notwendig. Das ist nicht neu. Am Ende stehen dann die Schneeerzeuger, deren Effizienz inzwischen sehr genau mit dem „Obergurgler Verfahren“ getestet werden können. Der MM habt darüber schon berichtet, die Testungen auch vor Ort in Skigebieten sind inzwischen Routine und eingespielt. Ich komme darauf später noch zurück. Ein wesentliches Ergebnis der Effizienztestung ist auch die Tauglichkeit der Anlage im Grenztemperaturbereich. Im vergangenen Winter haben wir sehen müssen, dass so mancher Skibetrieb später als erhofft in Betrieb gehen konnte, weil es für die Beschneiung zu warm war. Beim Thema Schlagkraft muss man sich bewusst sein, dass die Dauer von Wetterlagen – die sogenannte Persistenz – größer zu werden scheint. Zwar stehen Klimatologen bei dieser Aussage noch etwas auf der Bremse (dazu später noch genauer), aber die Praxis beweist leider, dass es mit dem Nachschneien schwieriger wird. Wer also seine Saison absichern will, ist zunehmend dazu gezwungen zu „Klotzen“ statt zu „Kleckern“. Es könnte sonst unter Umständen nicht bis zur nächsten Kaltperiode reichen. Beides hat eine aus meiner Sicht unerfreuliche Auswirkung auf das Schneemanagement. Konnte man bisher bei geeigneter Beschneiungsstrategie Wasser und Energie in der Grundbeschneiung sparen und je nach Saisonverlauf nachschneien, nimmt der Klimawandel den Skigebieten diese Möglichkeit zunehmend aus der Hand. Wenn es zu Saisonbeginn kalt wird, dann muss man fast zwangsweise verantwortungsvoll für den eigenen Betrieb und die Region mit entsprechend ausreichender Schneeproduktion vorsorgen. Flapsig: Volles Rohr! Wir beobachten daher weiterhin Effizienzsteigerungsmaßnahmen, was weiterhin auch höchst notwendig ist. Ich muss aber festhalten, dass es um mehr geht. Die Betriebe müssen klimafit werden.
Was heißt das genau? Gibt es zum Klima und seinen Auswirkungen auf den Schneesport neue Erkenntnisse?
Ihr habt im letzten Jahr darüber berichtet, dass wir im Expertenforum „Klima.Sport.Schnee“ die Auswirkungen der neuesten Klimaforschungsergebnisse auf den Schneesport im Juli veröffentlichen wollten. Tatsächlich gelang uns das erst jetzt im vergangenen Juni 2025, weil die Daten zum Temperaturanstieg genau berücksichtigt werden sollten. Und diese Daten sind richtig ernüchternd. Nach neuesten Erkenntnissen beträgt die mittlere Erwärmung seit vorindustrieller Zeit bis Ende 2024 in Deutschland 2.5°C, in der Schweiz 2.9°C und in Österreich 3.1°C. Das Klimaziel von Paris 2015 war 1,5°C seit vorindustrieller Zeit und hier sind wir in Österreich jetzt schon bei mehr als dem Doppeltem!
Du hast vorhin erwähnt, dass ein wesentliches Ergebnis eurer Effizienztestungen die Tauglichkeit der Anlage im Grenztemperaturbereich zeigt. Kann man das genauer beschreiben?
Machen wir ein konkretes Beispiel. Wir haben im Auftrag eines Skigebiets drei vorausgewählte Schneeerzeuger getestet und mit einander verglichen. Die Messergebnisse sieht man im eingangs dargestellten Bild: Bei annähernd identen Bedingungen (Temperatur, Feuchte, Wassertemperatur) wurden fast idente Schneequalitäten (Gewicht und Dichte) erzeugt. Den Wasserdruck und die Wassermenge mussten wir natürlich dazu jeweils anpassen, um diese gleichen Ergebnisse zu erzeugen. Hier gab es dann doch enorme Abweichungen. Wenn man die Maschinen 1 und 2 vergleicht, dann zeigt sich bei etwas höherem Wasserdruck von rund 6 bar aber einer Energieaufnahme von nur einem Drittel und einem doppelt so hohen Wasserdurchsatz, um wieviel besser die Maschine 2 arbeitet. Zudem liegt der Wasserverlust durch Verdunstung während der Beschneiung deutlich niedriger. Enger verlief das „Rennen“ zwischen den Maschinen 2 und 3. Hier entscheiden dann andere Faktoren, wie Betreuung, Preis, Wartung, Handling etc. Wenn dieselben Maschinen dann noch einem Test bei -1,5°C FKT unterzogen werden, dann kann man schon das deutlich bessere Produkt in Bezug auf Schlagkraft und Effizienz finden und wählen. Leider kann ich nicht weiter aus der Schule plaudern, weil die Tests fast allesamt strengen NDA-Vereinbarungen unterliegen. Aber wir testen jetzt doch schon einige Jahre und es manifestieren sich unsere Beobachtungen. Einiges deutet darauf hin, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Manche Hersteller haben immer ein Produkt unter den besten Schneeerzeugern, aber keines bei den schlechtesten und bei anderen Herstellern ist es dann eben umgekehrt.
Jetzt wird es aber schon spannend, kannst Du nicht Namen nennen?
Ich verstehe die Frage, ich frage mich auch selbst oft, wann wir mit gutem Gewissen den sich abzeichnenden Trend mit Namen belegen, komme aber doch – zumindest noch – zum Schluss, dass die Anzahl unserer Tests und die Unterschiede in den Schneibedingungen nicht ausreicht, um den Nagel verlässlich einzuschlagen. Leider kommt auch noch dazu, dass wir mit unseren Partnern immer wieder auch an den Basics der Beschneiung „herumdoktern“ müssen. D.h. dass manche Tests interpretiert werden müssen, weil falsche Maschineneinstellungen, Fehler bei der Wasserdruckdosierung oder auch Aufzeichnungsfehler bei der Testdauer das notwendig machen. Bei groben Unterschieden ist das kein Problem, wenn die Unterschiede aber relativ gering sind, so wie z. B. bei den Maschinen 2 und 3 oben, dann reicht das aus meiner Sicht nicht, um professionell zu urteilen. Ich kann nur empfehlen sich mit der eigenen Beschneiungsanlage genau zu beschäftigen. Wer für seine Beschneiungsanlage ein genaues Ergebnis haben will, der kann das aber verlässlich bekommen.
Eure Tests zeigen ja bis zu einem gewissen Grad auch die Grenzen des Machbaren auf? Muss sich der Wintersport aus Deiner Sicht Sorgen um seinen Bestand machen?
„Der Wintersport“ nicht, aber manche Destinationen und auch einzelne Events schon und bei all dem muss man die Rolle der Medien im Auge behalten. Der zweite Österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel ( APCC 2025, AAR2 https://aar2.ccca.ac.at/download-de) führt uns drastisch vor Augen, wohin die Reise leider zu gehen droht. Auch das Expertenforum Klima.Sport.Schnee, in dem ich mitarbeiten darf, hat für den Wintersport in den Alpen darauf hingewiesen, dass 1. die Schneedecke langfristig zurückgehen, 2. sich die Anzahl und Dauer der Beschneizeiten verringern und 3. sich der Wasser- und Energiebedarf erhöhen wird. Es werden sogar erste Nutzungskonflikte sichtbar. Das ganze Positionspapier ist unter https://www.stiftung.ski/dflip/expertenforum_2025.html einsehbar. Folglich werden weitere Skilifte aus ökologischen oder ökonomischen Gründen ihren Betrieb einstellen müssen. Das kommt nicht überraschend, wir können/müssen das ohnehin schon seit Jahren verfolgen.

Das Expertenforum „Klima.Sport.Schnee“, veröffentlichte den aktuellen Forschungsstand zum Thema „Perspektiven des Winter- und Bergsports im Zeichen globalen Klimawandels“.
Was setzt Ihr dem zunehmenden medialen Druck entgegen?
Große Events wie beispielsweise sogar Weltcup-Rennen kommen unter medialen Druck. Die Baden-Württembergische Filmakademie hat im letzten Winter in St. Anton den Aufwand für WC-Rennen unter die Lupe genommen, mit Klimaforschern das Thema genau beleuchtet und sich von uns zeigen lassen, wie die Beschneiungseffizienz gemanagt werden kann. Das Ergebnis ist eine 90-minütige Doku mit dem Titel „Abfahrt auf Zeit“, die im Herbst in die Medien kommen wird. Hier in Gurgl konnten wir mit unseren Tests zeigen, dass die Rennen in Hochgurgl sogar zu einer Effizienzsteigerung geführt haben. Der Klimawandel und die Medien spornen daher durchaus auch an. Wenn aber z. B. das Kandahar-Rennen in Garmisch-Partenkirchen abgesagt werden muss, dann hat das enorm negative Auswirkungen. Mit Servus TV haben wir letzten Winter eine Trilogie zum Themenschwerpunkt ökologisch verantwortliche Beschneiung gemacht, die aus meiner Sicht nicht nur die Verantwortung in den Skigebieten sehr gut aufgezeigt hat, sondern auch sehr positive Beispiele, wie mit ihr umgegangen wird. Im großen Medienrauschen geht so etwas aber fast unter. Im Anton Pustet Verlag wird gerade ein Buch zum Thema „Zukunft des Skifahrens“ redigiert, das im Wesentlichen die Auswirkungen auf die Natur aufzuzeigen versucht. Wieder ein Beispiel, dass der Druck auf den Wintersport weiter steigen wird. Unter dem Strich heißt das für mich, dass die Anstrengungen zu den Themen Ressourceneinsparung und Effizienzsteigerung weiter erhöht werden müssen.

Mit Servus TV hat das Schneezentrum Tirol letzten Winter eine Trilogie zum Themenschwerpunkt „ökologisch verantwortliche Beschneiung“ gemacht.
Zum Schluss: wie geht es bei Euch weiter?
Wir testen im nächsten Winter die gesamten Neuentwicklungen eines Herstellers, werden in einem Südtiroler Skigebiet ein Projekt zur Effizienzsteigerung der Pistenpräparierung begleiten, planen den Ausbau unseres Labors und sind in vielen neuen Forschungsprojekten engagiert. In Obergurgl geht ein neues Speicherteichprojekt von der Planung in die Umsetzungsphase, wir werden dort das Thema effiziente Wasserkühlung begleiten. Beispiele für aktuelle Forschungsprojekte wären: das FuturLab des Landes Tirol zur Zukunft des Wintertourismus, das europäische Projekt zur Klima-Resilienz in den Alpen – „Mount Resilienz“ , ein spannendes Projekt im Stollen von Hagerbach in der Schweiz zur Effizienzsteigerung im Wassermanagement beim Snowfarming und vieles mehr. Und zur Frage, wie der nächste Winter wird, sage ich aber nichts mehr. Letztes Jahr lag ich ja mit meiner Einschätzung: „kalt und schneeweiß“ nicht so ganz richtig….
Wir danken für das Gespräch!
mak
© cm
Coming soon: the supplement snowmaking
Die neueste Ausgabe Nr. 4/25 der Fachzeitschrift Mountain Manager mit der Beilage zum Thema „technische Beschneiung“ wird nächste Woche verschickt. Das Supplement enthält auch technische Tabellen zu den Propellermaschinen und Schneeerzeugern verschiedener Hersteller. Darüber hinaus beinhaltet die Beilage informative Artikel.
Auszug aus dem Inhalt der Beilage „technische Beschneiung“:
- Interview Mag. Michael Rothleitner, Schneezentrum Tirol: Der Klimawandel trennt die Spreu vom Weizen.
- DEMACLENKO: Maximale Effizienz und Wartungsfreundlichkeit mit dem E-TOWER;
- Optimierung mit dem SNOWMASTER von TechnoAlpin ;
- Bächler Top Track AG: Der „Pioneer“ testet wieder.
- Innovative und kosteneffiziente Speicherseeumwälzung mit OLOID;
- Schneeprophet mit dem SIS ECO Award 2025 ausgezeichnet.
- MND Snow: eine neue Generation von Schneeerzeugern;
- Supersnow präsentiert die 900 H.
Das MM-Team wünscht eine interessante Lektüre!
© cm
Check it out: the Mountain Manager 4/25
Die neueste Ausgabe wird nächste Woche versendet und hat unter anderem den Bergsommer, Trends im Sommergeschäft, die Ökologie und die technische Beschneiung als Schwerpunkte. Eine eigene Beilage zum Thema „technische Beschneiung“ bietet interesssante Arikel zu dieser Thematik. Technische Tabellen über Propellermaschinen und Schneilanzen unterschiedlicher Hersteller bieten detaillierte Einblicke. Mehr über das Supplement erfahren Sie demnächst bei uns online.
Auszug aus dem Inhalt des Mountain Manager 4/25:
- Meinung: Mag. Günther Aigner, Zukunft Skisport: „Beschneiung ist ökologischer als Polemiker glauben.“
- SUPERSNOW feiert 25 Jahre-Jubiläum.
- Vielversprechender Start der Schweizer Sommersaison;
- Millionen Urlauber zieht es in Österreichs Berge.
- Bikepark am Großen Arber eröffnet;
- Neuerungen beim Bikepark auf der Planai;
- Professionelle Fahrradwäschen steigern das Bike-Erlebnis.
- Rupert Schiefer: Das klassische Saisondenken ist vorbei.
- Solar-Forschungsprojekt SLF Davos: Licht ist nicht gleich Licht.
- MM-Interview: Manuel Schnell, Geschäftsführung Ski amadé: „Die Herausforderungen sind größer geworden.“
Das MM-Team wünscht eine interessante Lektüre!
Auch 2023 nutzten mehr Wanderer die Südtiroler Seilbahnen als im Vorjahr. @IDM Südtirol-Alto Adige/Manuel Kottersteger
Südtiroler Seilbahnen mit Beförderungsrekord
Mit 143,4 Millionen beförderten Personen haben die Südtiroler Seilbahnanlagen in der Wintersaison 2023/2024 den bisherigen Allzeitrekord (= +2,6 % gegenüber dem Vorjahr) erreicht. Der Sommerskilauf ist zwar weiterhin rückläufig, aber dafür steigt die Zahl der Wanderer oder Pendler, die die Seilbahn nutzen, stetig. Im Sommer 2023 hat sie sich im Vergleich zu 2022 um 2,3 % erhöht. Auch die Langzeittendenz ist positiv: Waren es im Sommer 2000 ungefähr 4 Millionen beförderte Wanderer und Pendler, sind es im Sommerhalbjahr 2023 mit 10,9 Millionen fast dreimal so viele gewesen.
Das geht aus dem aktuellen Bericht „Seilbahnen in Südtirol – 2023 und 2024“ hervor, den das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) in Zusammenarbeit mit dem Amt für Seilbahnen erstellt hat.
54,1 % mehr Investitionen als im Vorjahr getätigt
Die Südtiroler Seilbahnen erwirtschafteten in diesem Zeitraum einen Gewinn von 77,6 Mio. Euro, bei stabilen Betriebserträgen (522 Mio. Euro) und Aufwendungen (422 Mio. Euro). Sie investierten rund 161 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 54,1 % entspricht. Davon entfallen 103 Mio. Euro (64,2 %) auf die Infrastrukturen, 34 Mio. Euro (21,2 %) auf den Kauf von Betriebsgeräten (Schneekatzen, Fahrzeuge, Propellermaschinen usw.) und 23,5 Mio. Euro (14,6 %) auf sonstige Investitionen.
354 Seilbahnanlagen in Südtirol
Mit Stichtag Ende Dezember 2024 gab es in Südtirol 354 Seilbahnanlagen, drei Anlagen weniger als im Vorjahr. 58,8 % der Seilbahnen wurden nach 2000 errichtet, das Durchschnittsalter beträgt 23 Jahre. Die Anzahl der Schlepplifte hat sich von 310 (1980) auf 98 (2024) reduziert. 2024 wurden sechs neue Seilbahnanlagen errichtet und neun abgebaut.
Folgende Seilbahnanlagen wurden 2024 realisiert:
- Skigebiet Schwemmalm, Ultental: Ersatz von zwei fix geklemmten Sesselliften durch eine kuppelbare 6er-Sesselbahn mit einer Förderleistung von 2.200 P/h.
- Karerpass: Ersatz des bestehenden Schlepplifts durch einen neuen Schlepplift auf gleicher Trasse. Förderleistung: 895 P/h.
- Skigebiet Vals-Jochtal: Ersatz eines fix geklemmten 4er-Sessellifts durch eine kuppelbare 6er-Sesselbahn mit Wetterschutzhaube und einer Förderleistung von 2.400 P/h.
- Skigebiet Kronplatz: Anlage „Plateau“: Bau der ersten 8er-Sesselbahn des Typs D-Line in Italien mit Sitz- und Rückenlehnenheizung, Wetterschutzhaube sowie automatischen und verriegelbaren Schließbügeln. Förderleistung: 3.600 P/h.
- Alta Badia (Hochabtei): Ersatz der bestehenden kuppelbaren Sesselbahn Braia Fraida durch eine neue 6er-Sesselbahn mit einseitiger Mittelstation. Förderleistung: 2.800 P/h.
- Skigebiet Rotwandwiesen: Ersatz des bestehenden Schlepplifts Porzen durch eine kuppelbare 6er-Sesselbahn mit geänderter Trasse für bessere Anbindung an das restliche Skigebiet. Förderleistung: 2.200 Personen pro Stunde.
- Skigebiet Rosskopf/Sterzing: Noch vor Jahresende 2024 wurde das System „LeitPilot“ an der Kabinenbahn Sterzing-Rosskopf als Prototyp für die Erreichung der Zulassung in Italien eingebaut und versuchsweise in Betrieb genommen. Es handelt sich um die erste Anlage mit unbemannter Umlenkstation in Italien.
Technische Beschneiung unverzichtbar
Um die Wettbewerbsfähigkeit der Wintertourismusorte zu sichern, sind auch laufende Investitionen in die technische Beschneiung ausschlaggebend. So wurden 2023 in Südtirol insgesamt 5.061 Schnee-Erzeuger (Propellermaschinen und Schneilanzen) gezählt, das ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von 6,1 %. Somit hat sich die Zahl der Schnee-Erzeuger in den vergangenen 20 Jahren fast verfünffacht. Durch die Automatisierung der Beschneiungsanlagen haben sowohl die Anzahl der Schnee-Erzeuger als auch die Investitionen zugenommen.
Wichtiger Arbeitgeber in Südtirol
2023 waren 2.382 Personen in der Seilbahnbranche beschäftigt, 121 mehr als im Vorjahr (+ 5,3 %). Damit erzielte die Anzahl der Festangestellten und der Saisonarbeitskräfte wieder das Vor-Corona-Niveau.
Weitere Details sind nachzulesen auf:
https://astat.provinz.bz.it/de/publikationen/seilbahnen-in-suedtirol-2023-und-2024